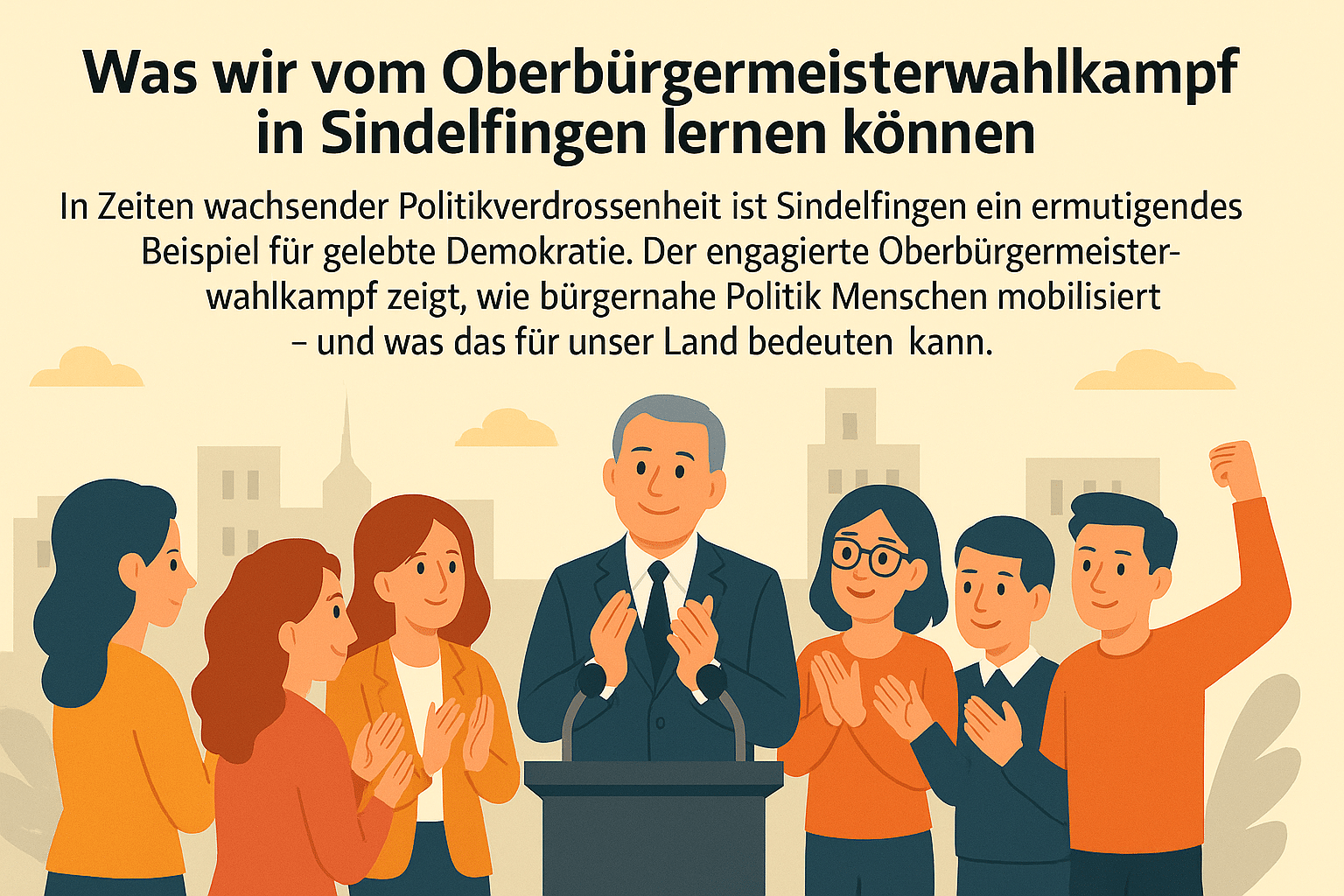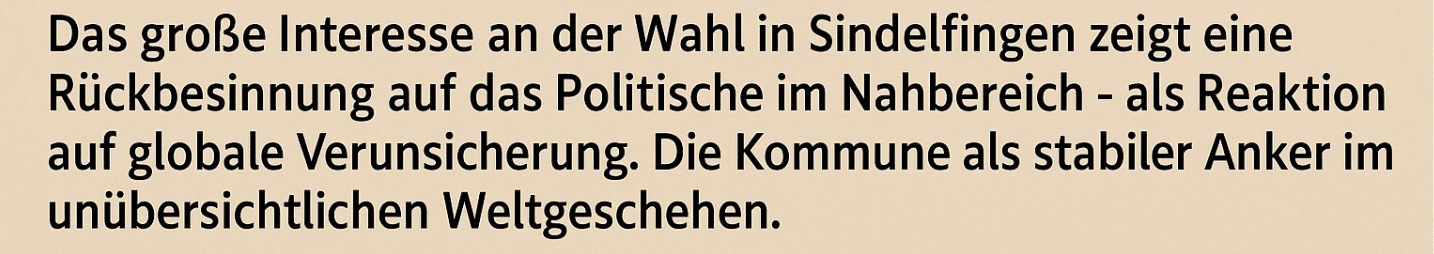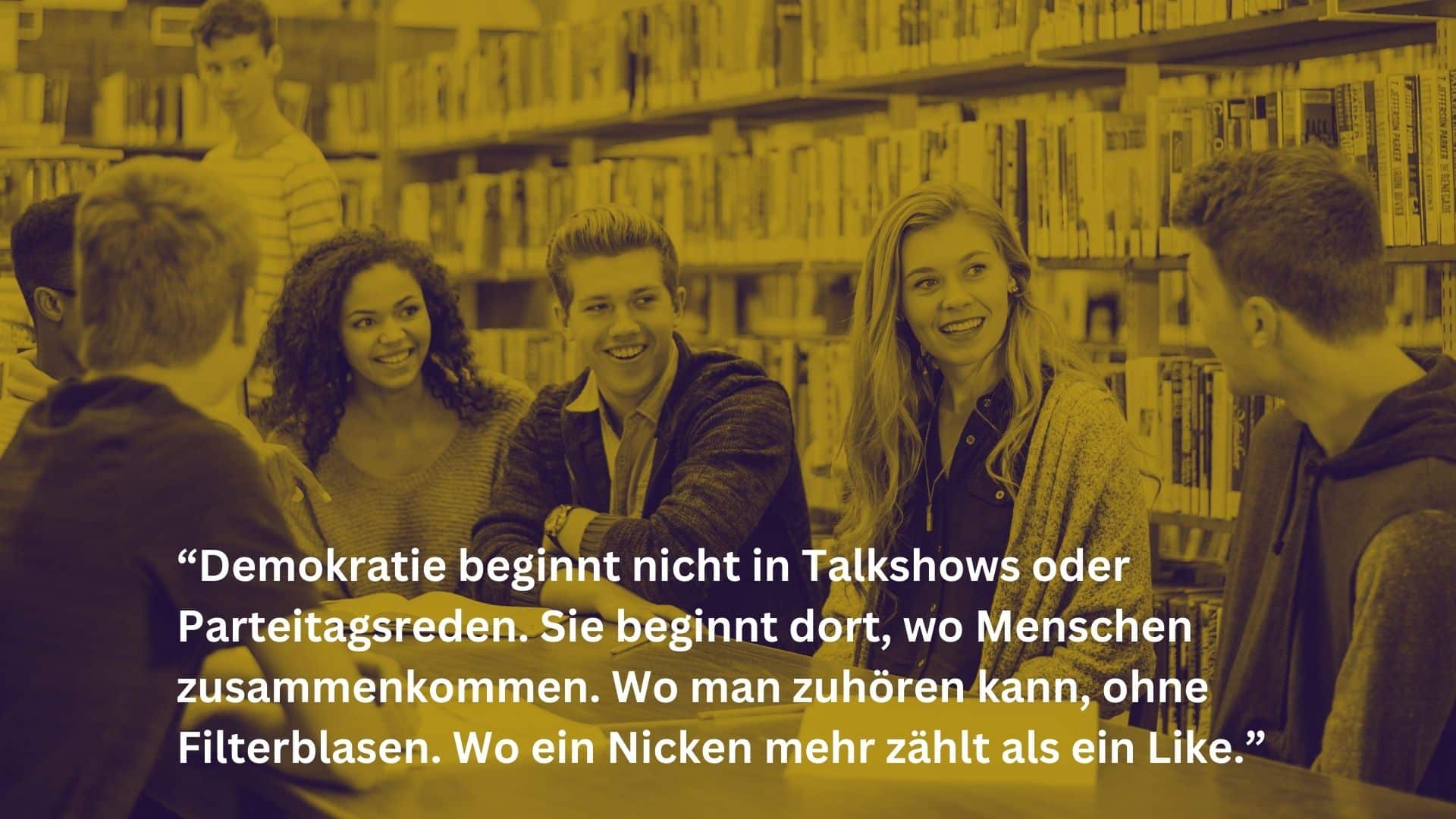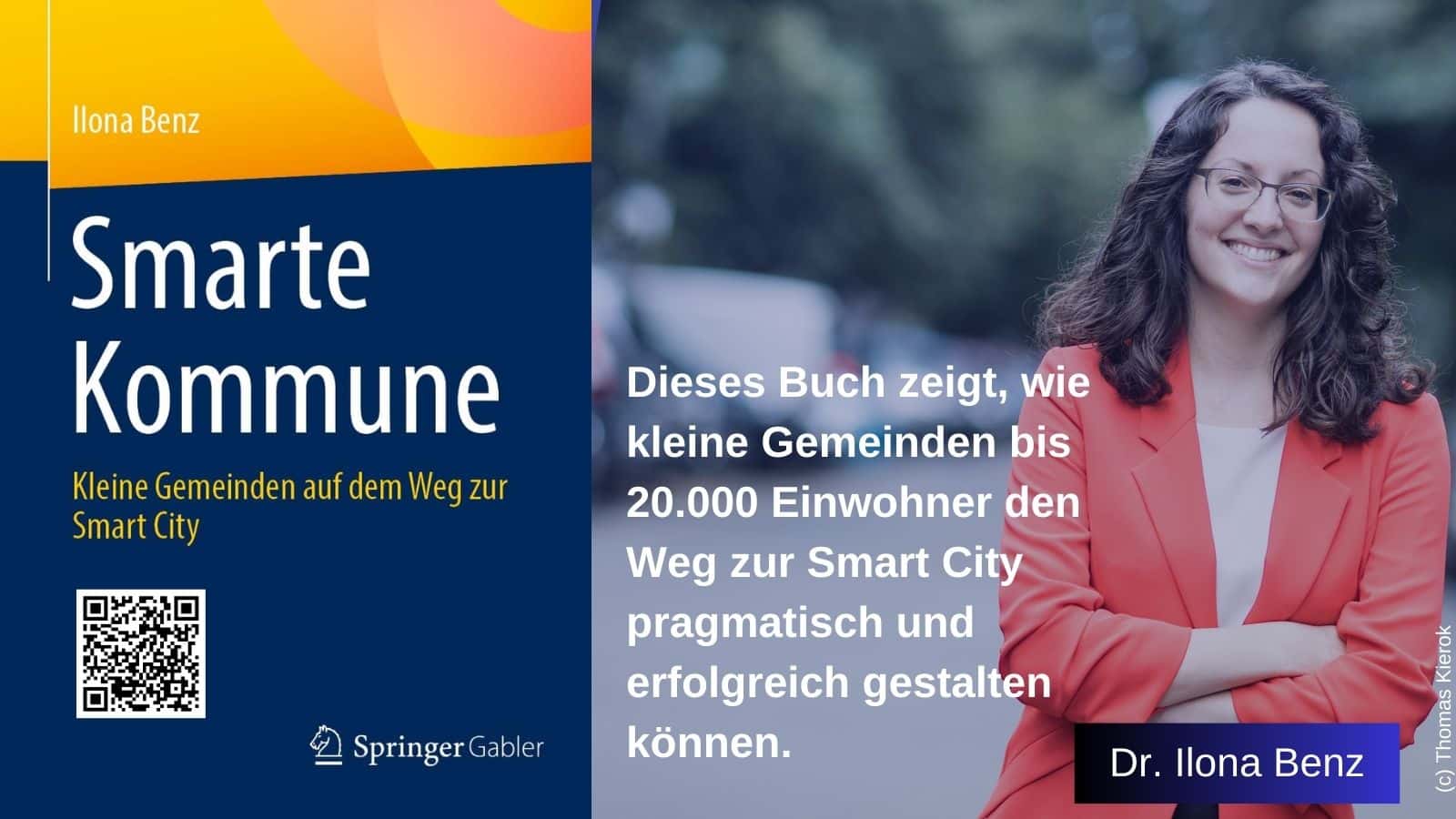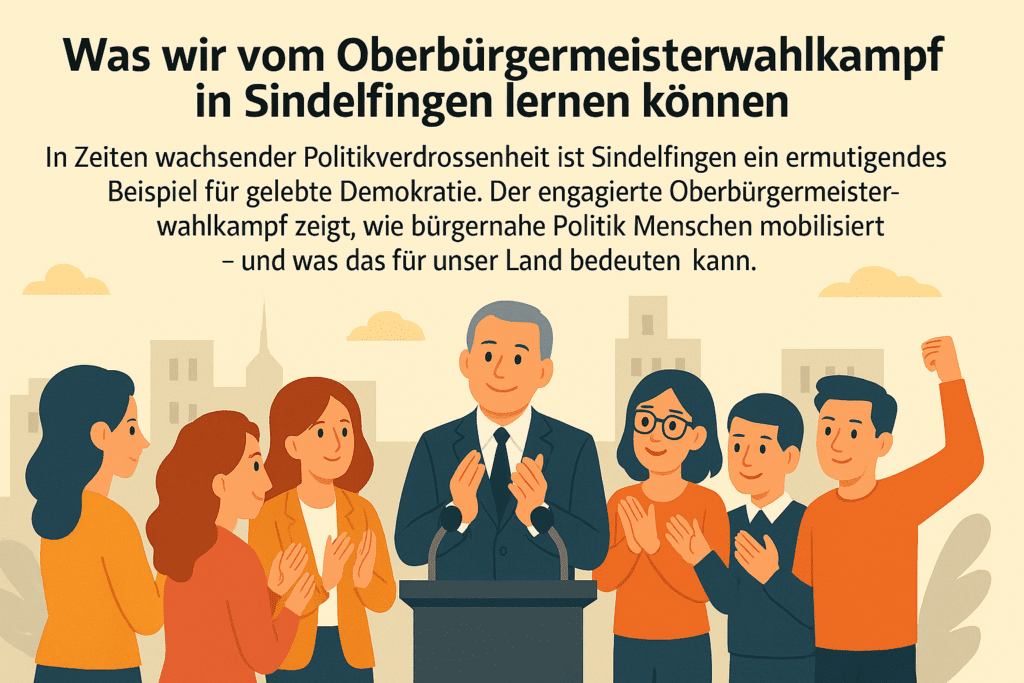Im Z-M-I, dem Zehn-Minuten-Internet Newsletter berichten Franz-Reinhard Habbel und Gerd Landsberg jeden Sonntag über interessante Links (heute u.a. OB-Wahl in Sindelfingen) aus dem Internet für Bürgermeister:innen und Kommunalpolitiker:innen.

Was wir von der Oberbürgermeisterwahl in Sindelfingen lernen können
In Zeiten wachsender Politikverdrossenheit ist Sindelfingen ein ermutigendes Beispiel für gelebte Demokratie. Der engagierte Oberbürgermeisterwahlkampf zeigt, wie bürgernahe Politik Menschen mobilisiert – und was das für unser Land bedeuten kann.
Der Oberbürgermeisterwahlkampf in Sindelfingen verdient bundesweite Aufmerksamkeit. Neun Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich am 11. Mai 2025 in der 65.000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg zur Wahl. Während sich andernorts kaum jemand für ein solches Amt interessiert, herrscht hier ein reges demokratisches Treiben. Eine lebendige Bürgerschaft mischt sich ein – und das in Zeiten, in denen kommunales Engagement andernorts oft nur schwer zu entfachen ist.
Dies zeigen schon die Zahlen: Mehr als 1.300 Bürgerinnen und Bürger strömen zu einer zentralen Veranstaltung in die Sindelfinger Stadthalle. Diese Veranstaltung ist kein Einzelfall. Zahlreiche Vereine, Verbände, Unternehmen, Parteien und die Feuerwehr laden die Kandidatinnen und Kandidaten zu Gesprächen ein. Dort reichen die Räume angesichts des Andrangs oftmals nicht aus und es muss improvisiert werden. Auf Wochenmärkten wird diskutiert, in der Lokalpresse kommentiert, in den sozialen Medien argumentiert. Was sich hier abzeichnet, ist eine stille Renaissance der Kommunalpolitik – eine bewusste Rückbesinnung auf die konkrete, greifbare Ebene der Demokratie.
Warum ist das so? Ein Teil der Antwort liegt in den Themen: Infrastruktur, Bildung, Wohnen, Digitalisierung, Wirtschaftsförderung, Klima, Sicherheit – alles Themen, die auch anderswo wichtig sind. Doch in Sindelfingen kommt ein besonderer Moment hinzu: Nach 24 Jahren tritt der bisherige Amtsinhaber nicht mehr an. Eine Ära geht zu Ende. Viele Bürgerinnen und Bürger haben in ihrem ganzen Leben noch nie einen Wechsel an der Stadtspitze erlebt. Allein das lässt aufhorchen.
Globaler Kontrollverlust – lokale Selbstwirksamkeit: Und doch greift diese Erklärung zu kurz. Ein Blick auf das Weltgeschehen offenbart tiefer liegende Motive. Krieg in Europa, Klimakrise, Migration, wirtschaftliche Verwerfungen – die großen Herausforderungen überfordern viele. Gleichzeitig verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in die politische Debatte: Polarisierung, Populismus, Fake News – all das nagt am demokratischen Fundament. Manche sprechen offen von einer Erosion des Staates.
Aber Demokratie beginnt nicht in Talkshows oder Parteitagsreden. Sie beginnt dort, wo Menschen zusammenkommen. Wo man zuhören kann, ohne Filterblasen. Wo ein Nicken mehr zählt als ein Like. Genau das passiert in Sindelfingen. Die Stadtgesellschaft begegnet der Politik nicht mit Abwehr, sondern mit Teilhabe. Respekt ist hier kein Schlagwort, sondern gelebter Umgang.
Die Kandidaten verstehen sich als Impulsgeber, nicht als Verwalter des Status quo. Sie treten in den Dialog, formulieren Ziele, hören zu. Das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist der Rohstoff, aus dem politische Gestaltungskraft erwächst. In Sindelfingen wird spürbar, dass Demokratie mehr sein kann als Verwaltung: die gemeinsame Suche nach dem richtigen Weg in die Zukunft – vor Ort, im Alltag, im Gespräch.
Kommunen als Schlüsselorte der Demokratie: Das große Interesse an der Wahl in Sindelfingen zeigt eine Rückbesinnung auf das Politische im Nahbereich – als Reaktion auf globale Verunsicherung. Die Kommune als stabiler Anker im unübersichtlichen Weltgeschehen.
Wer über die Zukunft der Demokratie spricht, darf nicht bei Verfassungsdebatten stehen bleiben. Die entscheidenden Schlachten werden nicht in Berlin oder Brüssel geschlagen, sondern in Rathäusern, Gemeinderäten und Stadtteilzentren. Bund und Länder sind gut beraten, diesen Orten mehr zuzutrauen: weniger Bürokratie, mehr Gestaltungsspielraum und eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen.
Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind nicht nur Verwaltungsbeamte. Sie sind Übersetzer zwischen Bürgern und Staat, Moderatoren eines Aushandlungsprozesses. Der OB-Wahlkampf in Sindelfingen ist mit seinen vielen Aktivitäten und der Beteiligung der Stadtgesellschaft kein kommunales Randphänomen, sondern ein Lehrstück für das ganze Land.
Die Kommunen sind die erste und nicht die unterste Ebene des Staates und die Basis der Demokratie. Sindelfingen zeigt, wie es geht. Wie sich eine Stadt auf den Weg macht, Verantwortung zu übernehmen. Wie Demokratie nicht nur verwaltet, sondern gestaltet wird. Statt das politische System schlecht zu reden, sollten wir hinschauen – und sehen, dass es funktioniert. Dort, wo es ernst genommen wird. (Franz-Reinhard Habbel)
Bundesweiter Warntag 2024 – Mehrheit vertraut nationalem Warnsystem
Rund zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger vertrauen dem nationalen Warnsystem. So lautet die Kernbotschaft einer repräsentativen Umfrage, die anlässlich des Bundesweiten Warntags am 12. September 2024 durchgeführt wurde. 98 Prozent der Befragten finden es zudem wichtig, alle Warnkanäle regelmäßig zu testen und erkennen die hohe Relevanz des Bundesweiten Warntags.
Heilbronner Elektroautos laden am leichtesten öffentlich
Die Versorgung mit Lademöglichkeiten schwankt quer durch die Bundesrepublik stark. Die Spitze ist gemischt, die Schlusslichter dabei ausschließlich im Westen.
Stadt-Begrünung könnte Zahl der Hitzeopfer deutlich senken
Mehr Pflanzen in Städten könnten die Zahl der Hitzeopfer laut einer neuen Studie deutlich senken. Würde die Vegetation in städtischen Arealen weltweit um 30 Prozent steigen, so würde die Zahl der hitzebedingten Todesfälle um etwa ein Drittel abnehmen, heißt es. Besonders stark von mehr Grün profitieren könnten demnach Stadtbewohner in Süd- und Osteuropa sowie in Süd- und Ostasien.
Bürgergeld: Neustart in der Sozialpolitik überfällig – klare Regeln, klare Zuständigkeiten, europäische Verantwortung
Die Ausgaben für das Bürgergeld steigen seit Jahren kontinuierlich – und die Dynamik nimmt zu. Im Jahr 2024 beliefen sich die Gesamtkosten auf 46,7 Milliarden Euro, das sind 3,5 Milliarden Euro mehr als noch im Vorjahr. 22,1 Milliarden Euro entfielen auf Regelsätze und Sozialbeiträge, weitere 17,7 Milliarden auf die Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Kommunen, die sich an den Unterkunftskosten beteiligen, mussten fast 400 Millionen Euro zusätzlich aufbringen – insgesamt 6,9 Milliarden Euro.
Diese Zahlen zeigen deutlich: Die derzeitige Ausgestaltung der Grundsicherung ist weder finanziell nachhaltig noch strukturell tragfähig. Wir brauchen einen grundlegenden Neustart in der Sozialpolitik – insbesondere in Bezug auf das Bürgergeld. Es genügt nicht, an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Was notwendig ist, ist eine tiefgreifende Neuordnung: mit klaren Regeln, verständlichen Verfahren und eindeutigen Verantwortlichkeiten.
Die bestehenden Regelungen sind übermäßig kompliziert, stark auf Einzelfälle fokussiert und für die Jobcenter kaum noch praktikabel. Statt Menschen zügig und effektiv in Beschäftigung zu bringen, verlieren sich die Verfahren in Ausnahmen, Ermessensspielräumen und langwierigen Prüfungen. Das Prinzip „Fördern und Fordern“, das ursprünglich als Leitbild gedacht war, ist in der Praxis aus dem Gleichgewicht geraten. Wir fördern – aber fordern zu wenig.
Das Leistungsniveau des Bürgergeldes ist im europäischen Vergleich hoch – insbesondere, wenn man Unterkunftskosten, Sozialbeiträge und Zusatzleistungen berücksichtigt. Das führt zu Fehlanreizen. Während in Polen mehr als 70 Prozent der aus der Ukraine Geflüchteten bereits in Arbeit sind, liegt die Quote in Deutschland bei lediglich rund 30 Prozent. Das liegt sicher nicht nur am Sozialsystem, aber es trägt erheblich zur gegenwärtigen Schieflage bei.
Daher ist es richtig und notwendig, bei Neuankömmlingen aus der Ukraine wieder auf das Asylbewerberleistungsgesetz zurückzugreifen. Die Grundsicherung nach SGB II sollte jenen vorbehalten bleiben, die dauerhaft in Deutschland leben und arbeiten können. Zugleich muss der Bund endlich die vollständige Finanzverantwortung für die Unterkunftskosten übernehmen – unabhängig davon, ob es sich um Bürgergeld- oder Sozialhilfeempfänger handelt. Die Kommunen können diese Ausgaben nicht beeinflussen und sind dennoch in erheblichem Umfang finanziell belastet. Wer steuert, muss auch zahlen – das gilt in diesem Fall eindeutig für den Bund.
Ein weiterer, zentraler Punkt: Wir brauchen ein einheitliches europäisches Leistungsniveau für Geflüchtete und Vertriebene. Solange die Sozialleistungen in Europa stark variieren, wird es weiterhin massive Pull-Effekte nach Deutschland geben. Eine abgestimmte europäische Lösung, die einheitliche Mindeststandards bei Unterbringung, Versorgung und Integrationsleistungen vorsieht, ist überfällig. Nur so lässt sich eine faire und ausgewogene Verteilung von Schutzsuchenden erreichen – und nur so verhindern wir eine Überlastung einzelner Staaten.
Gleichzeitig muss das Bürgergeld in seiner jetzigen Form grundlegend reformiert werden. Wir brauchen klare Regeln statt Einzelfalljuristerei, größere Spielräume für die Jobcenter und eine Arbeitsvermittlung, die tatsächlich funktioniert. Die Integration in Arbeit muss wieder das zentrale Ziel sein – nicht die bloße Verwaltung der Hilfebedürftigkeit.
Wenn wir die Wende in der Sozialpolitik nicht endlich schaffen, wird das nicht nur zur Dauerbelastung für die öffentlichen Haushalte, sondern auch zum Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir brauchen mehr Menschen in Arbeit – nicht mehr Menschen im Transfersystem. Die Zeit zu handeln ist jetzt. (Gerd Landsberg)
Foto für Ausweis muss digital vorliegen
Der Gang zum Amt soll einfacher werden: Für Reisepässe und Personalausweise sind ab Anfang Mai nur noch digitale Fotos gültig. Bis Ende Juli können Bürgerinnen und Bürger übergangsweise aber wie gewohnt ein Bild in Papierform mitbringen.
„Wir haben für die Digitalisierung und Modernisierung unseres Staates bisher zu wenig getan. Ich möchte, dass sich das grundlegend ändert. Auch in den Querschnitts-Zuständigkeiten. Nur dann kann ein solches Ministerium erfolgreich sein.“
Friedrich Merz am Montag bei der Vorstellung von Karsten Wildberger als designierten
Digitalminister
Von wegen Behördenservice: Zwei Drittel der Deutschen fühlen sich als „Bittsteller“
Eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des estnischen Programms e-Residency zeichnet ein kritisches Bild vom Zustand der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Demnach fühlen sich 67,4 Prozent der Befragten im Kontakt mit Behörden wie Bittsteller und erleben staatliche Prozesse als unnötig belastend. 58,5 Prozent haben das Gefühl, von der Verwaltung nicht ernst genommen zu werden und vermissen eine serviceorientierte Ansprache.
Besonders deutlich fällt die Kritik bei den jüngeren Bürgerinnen und Bürgern im Alter zwischen 18 und 29 Jahren aus: Fast 80 Prozent von ihnen fühlen sich im Umgang mit Behörden nicht auf Augenhöhe behandelt. Doch auch in der Altersgruppe über 65 empfindet noch rund jeder Dritte ähnlich. Regional zeigen sich Unterschiede: Während in Bundesländern wie Berlin und Hamburg bereits Fortschritte bei der Digitalisierung und beim Bürgerservice wahrgenommen werden, fühlen sich beispielsweise in Sachsen-Anhalt mehr als drei Viertel der Befragten als Bittsteller.
Die Studie macht zugleich deutlich, dass der Bedarf an digitalen Verwaltungsdienstleistungen enorm ist: 66,8 Prozent der Befragten wünschen sich insbesondere eine digitale Möglichkeit zur Wohnsitzummeldung. Auch digitale Anträge für Personalausweis oder Reisepass (57,9 Prozent), Führerscheinangelegenheiten (26,3 Prozent) sowie Dokumente wie Geburtsurkunden und Sozialleistungsanträge stehen weit oben auf der Wunschliste.
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen klar: Die bisherigen Fortschritte bei der Verwaltungsdigitalisierung werden zwar anerkannt, reichen aus Sicht der Bevölkerung jedoch nicht aus. Es besteht weiterhin großer Handlungsbedarf, staatliche Leistungen einfacher, nutzerfreundlicher und digital verfügbar zu machen.
Neues aus den Kommunalen Spitzenverbänden
DST: Gewerbesteueroasen gefährden Steueraufkommen aller Kommunen
DStGB: Deutscher Kommunalkongress 2025
DLT: Gesucht: gute Ideen für Integration am Arbeitsmarkt
GStBRLP: Kommunen erhöhen Eigenstromversorgung mit Strombilanzkreis
NSGB: Halbzeit beim Land – Endzeit bei den Kommunen!
NST: Hohe Erwartungen an die zweite Halbzeit der Landesregierung
SAHGT: Scheitern des Ganztagsausbaus droht
NWStGB: Kommunen benötigen Spielräume und Ressource
Städteverband SH: Kommunen warnen vor Vollbremsung beim Ganztagsausbau
Kopf der Woche: Karsten Wildberger, desginierter Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung
Buch der Woche: ..trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor E. Frankl
Mit 35 Jahren kam der österreichische Psychiater Viktor E. Frankl in ein Konzentrationslager. In den Jahren der Gefangenschaft lernte er, wie Menschen mit unvorstellbarem Leid umgehen und wie es selbst an Orten größter Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen.
Nach der Befreiung verfasste er in nur neun Tagen diesen bewegenden Erfahrungsbericht über seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz und Türkheim. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Buch zum Klassiker der Überlebensliteratur, Generationen von Leserinnen und Lesern finden darin Trost und Orientierung. In über fünfzig Sprachen übersetzt, bietet es eine faszinierende und auch heute noch tief bewegende Erkundung der menschlichen Willenskraft.
Zahl der Woche: 56 % Prozent haben ihr Smartphone bei einem Defekt schon mal reparieren lassen (Quelle bitkom)
Chatbot der Woche: HeRoBot des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Tweet der Woche: Landkreistag BW
Der #Glasfaserausbau in Baden-Württemberg ist vielerorts ins Stocken geraten. Im eigenwirtschaftlichen Ausbau deshalb, weil die TK-Unternehmen ihre Ausbauversprechen nicht in dem Maße und vor allem nicht in der Geschwindigkeit einhalten, wie es der Bürgerschaft und auch …
Zu guter Letzt: Diebe erbeuten 300.000 US-Dollar: Geldtransporter verliert säckeweise Scheine auf offener Straße
Bild Bürgergeld: Canva
Ihnen wurde der Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie in abonnieren
++++
Der ZMI kann kostenlos hier abonniert werden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ihr Franz-Reinhard Habbel