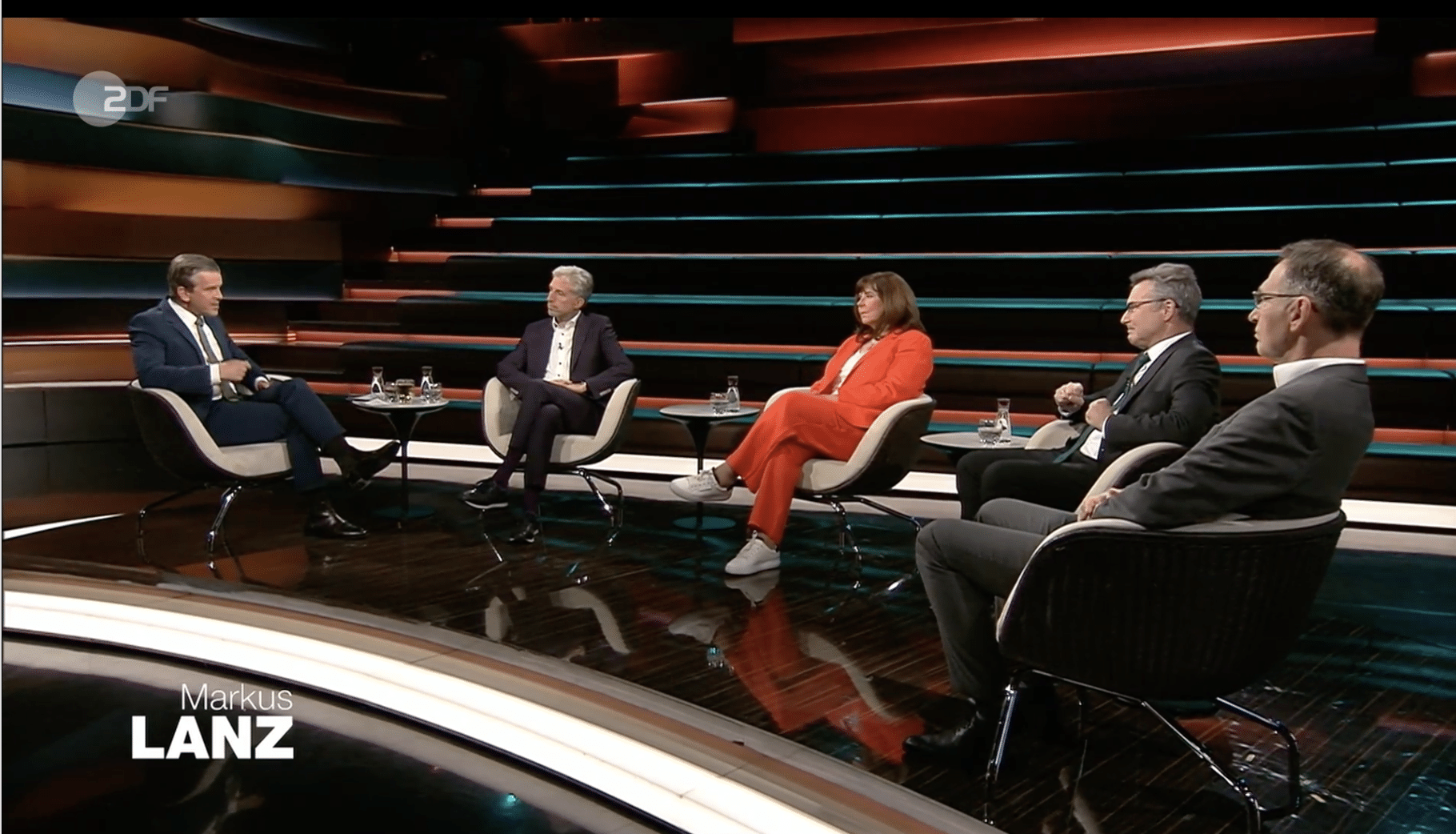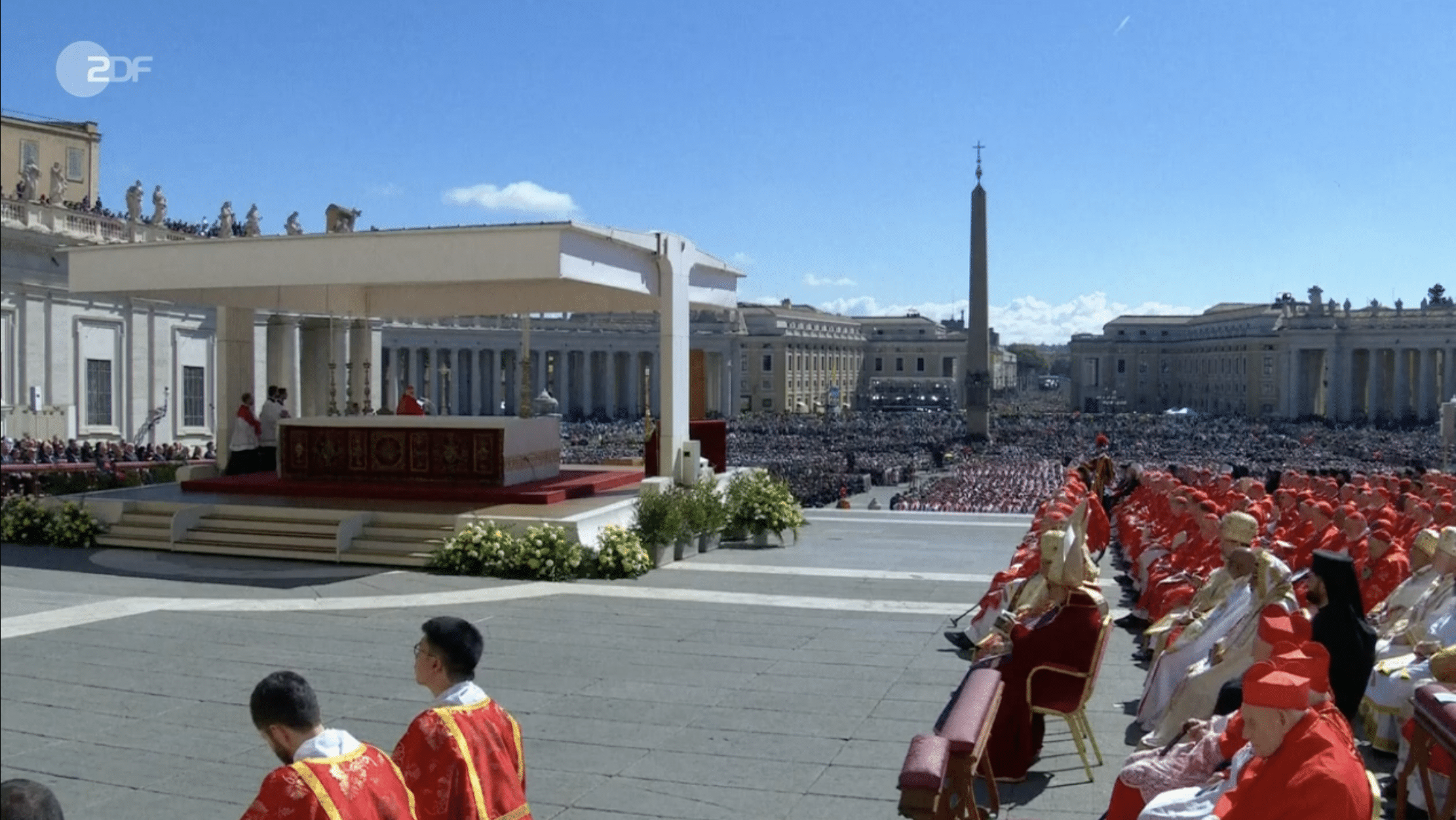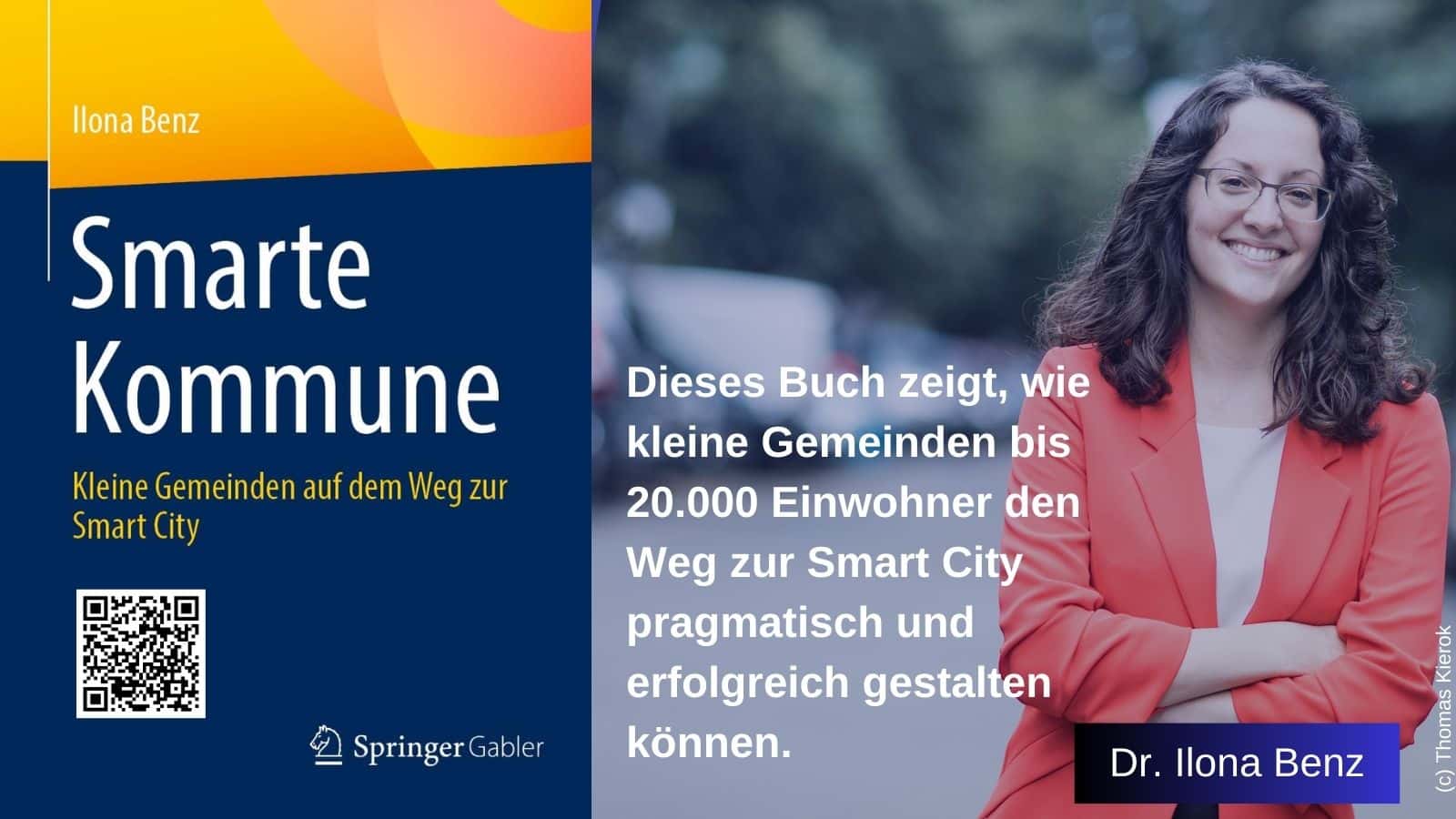Im Z-M-I, dem Zehn-Minuten-Internet Newsletter berichten Franz-Reinhard Habbel und Gerd Landsberg jeden Sonntag über interessante Links (heute u.a. Kommunen unter Druck) aus dem Internet für Bürgermeister:innen und Kommunalpolitiker:innen.

Kommunen unter Druck
In der vergangenen Woche wurde in einer bemerkenswerten Ausgabe der Sendung Markus Lanz über die strukturpolitischen Herausforderungen der Kommunen diskutiert.
Der Tübinger OB Boris Palmer und Ex-Grünen-Politiker sprach über die strukturpolitischen Herausforderungen seiner Stadt und erklärt, warum für ihn „zu wenig Veränderung“ im Koalitionsvertrag steckt. Der Präsident des Deutschen Landkreistages Achim Brötel legte die vielfältigen Probleme der Kommunen dar: „Wenn das Ruder nicht herumgerissen wird, fährt die kommunale Ebene flächendeckend vor die Wand.“ Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck will keine zweite Amtszeit. Sie berichtete von den Problemen aus ihrem Arbeitsalltag und erläutert ihre Sorge um den sozialen Frieden. Der Heider Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat nahm Stellung zur Bauverzögerung der Northvolt-Batteriefabrik, nachdem der schwedische Mutterkonzern insolvent gegangen ist. In der Sendung wurde deutlich wie das mittlerweile auf rund 25 Milliarden Euro angewachsene Defizit der Kommunen die Gestaltungsspielräume immer weiter einengt.
Zukunft ungewiss: Wie Frauen aus der Ukraine am Krieg leiden
Der Sohn kämpft an der Front, der Ehemann wird bei einem Raketenangriff verwundet, ein Schüler berichtet vom erschossenen Vater – geflüchtete Ukrainerinnen leben in Filderstadt in ständiger Angst um ihre Liebsten in der Heimat.
Neue Ausweise und Pässe bald auch per Post
Neue Ausweise, Reisepässe und andere Personalpapiere können künftig auch vom Briefträger nach Hause gebracht werden. Wie die Deutsche Post mitteilte, hat sie die Ausschreibung der Bundesdruckerei gewonnen. Demnach soll das neue Angebot in einer Woche starten. Für die Frei-Haus-Lieferung würden 15 Euro zusätzlich fällig, die bei der Antragstellung im Bürgeramt zu bezahlen seien. Für Führerscheine gilt die Neureglung allerdings nicht (Quelle: MDR AKTUELL vom 25.4.2025 19:35 Uhr)
Noch viele offene Fragen bei geplanter Videoüberwachung von Müllcontainern
Das Saarland arbeitet an einer Rechtsgrundlage, um Müllcontainer per Video überwachen zu können. Dabei sind aber noch viele Fragen offen
EU-Kommission beschleunigt Umsetzung des Migrations- und Asylpakets
2024 wurde das überarbeitete Migrations- und Asylpaket verabschiedet, das im Juni 2026 in Kraft tritt. Die Europäische Kommission (KOM) schlug am 16. April 2025 vor, zwei Elemente dieses Asylpakets vorzuziehen, um Asylanträge und -verfahren zu beschleunigen. Außerdem wurde eine überarbeitete Liste mit sicheren Herkunftsländern von der KOM vorgeschlagen, darunter befinden sich der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Die Anträge von Staatsangehörigen dieser Länder könnten so in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden. Dies soll nur drei statt sechs Monate, wie im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) vorgesehen ist, betragen.
Kirchenaustritte ernst nehmen – Seelsorge stärken, Orientierung bieten
Der Tod des Papstes und die weltweite Anteilnahme daran rücken die Kirchen erneut in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Gerade in Zeiten globaler Krisen und gesellschaftlicher Verunsicherung wird deutlich, wie groß das Bedürfnis nach Halt, Gemeinschaft und geistiger Orientierung ist.
Die hohe Zahl an Kirchenaustritten in Deutschland ist alarmierend. Sie bedeutet nicht nur den Verlust von Mitgliedern, sondern auch den Verlust eines wichtigen gesellschaftlichen Bindeglieds. Kirchen sind ein zentraler Baustein für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Sie schaffen Räume für Begegnung, vermitteln Werte und bieten Orientierung. In Regionen, in denen die kirchliche Bindung stark ausgeprägt ist, sind extremistische Strömungen nachweislich deutlich schwächer – das spricht für die stabilisierende Kraft des Glaubens und der gelebten Gemeinschaft.
Auch die gesellschaftliche Funktion der Kirchen wird oft unterschätzt: Ihre zahlreichen sozialen Dienste – etwa durch Caritas und Diakonie – tragen maßgeblich zur Versorgung und Begleitung der Schwächsten in unserer Gesellschaft bei. Diese Leistungen sind unverzichtbar, drohen aber zu erodieren, wenn die institutionelle und finanzielle Basis der Kirchen weiter schwindet.
Die Kirchen stehen daher vor der Aufgabe, eine klare Strategie zu entwickeln, wie sie die Menschen wieder stärker erreichen können. Im Mittelpunkt muss die Seelsorge für den Einzelnen stehen. Die Sehnsucht vieler Menschen nach Sinn, geistiger Tiefe und spiritueller Orientierung ist vorhanden – sie muss erkannt, ernst genommen und mit Leben gefüllt werden.
Ein wichtiger Ansatzpunkt bleibt dabei die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Noch gelingt es vielen Gemeinden, junge Menschen über Kindergottesdienste, Freizeiten und Bildungsangebote anzusprechen. Doch auch dieser Zugang gerät in Gefahr, wenn Eltern der Kirche den Rücken kehren und damit ihren Kindern diese Räume nicht mehr eröffnen.
Für die Zukunft der Kirchen ist es essenziell, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: Seelsorge, Gemeinschaft, spirituelle Begleitung und die grundlegenden Fragen von Leben und Tod. Eine langfristige Strategie kann es durchaus geboten erscheinen lassen, sich nicht zu jeder politischen Tagesfrage zu äußern, sondern vielmehr den spirituelle Anker in einer zunehmend orientierungslosen Gesellschaft zu stärken. (Gerd Landsberg)
Analyse der Deutschen Polizeigewerkschaft zum Koalitionsvertrag
Die Zeitenwende in der Inneren Sicherheit ist durch den Koalitionsvertrag möglich geworden. Zu ihrer Realisierung braucht es konsequente und mutige Politik – eine Analyse vom DPolG-Bundesvorsitzenden Rainer Wendt.
Elektronisch Identitäten als Schlüsselfaktor für die Digitalisierung in Verwaltung und Wirtschaft
Eine elektronische Identität (eID) ermöglicht eine sichere digitale Identifikation und Authentifikation für die Bürgerinnen und Bürger aber auch für die Wirtschaft. In einer elektronischen Brieftasche (Wallet) können damit verbunden wichtige Dokumente und Nachweise digital abgelegt und vorgezeigt werden. Die europäische eIDAS-Verordnung sieht vor, diese Funktionen in allen Mitgliedsstaaten verfügbar zu machen. In der Veranstaltungsreihe „forum digital“ analysierten Experten die aktuellen Hindernisse und diskutierten die notwendigen politischen Schritte, um die Potentiale von eID und Wallet in Deutschland und Europa nutzbar zu machen.
„One in, two out“
Die neue Bundesregierung von CDU/CSU und SPD will für jede neue Regelung zwei vorhandene Regelungen außer Kraft setzen. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu auf Seite 61: „Wir streichen die Ausnahmen der so genannten „One in, one out“-Regel und berücksichtigen den Aufwand aus EU-Vorgaben, den Aufwand für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung sowie den einmaligen Umstellungsaufwand, und entwickeln sie zu einer „One in, two out“-Regel fort.“
Nachdem nun über lange Jahrzehnte Bürokratieabbau gepredigt und in Einzelstücken versucht wurde, wäre mit einer konsequenten Anwendung des Prinzips „one in, two out“ über „one in, one out“ hinaus erstmalig eine tatsächliche Vorschriftenreduktion verbunden, wenn es denn über die zahlreichen Verwaltungen und deren Stufen im Föderalen System mit Blick bis zur EU und in Zusammenarbeit mit Bundesländern und Kommunen verbindlich gemacht würde.
Bürokratieabbau nach über 50 Jahren – jetzt wirklich neu? Mittels Politikwechsel im Bund?
Dazu braucht es zum einen im Rahmen des damit offenkundig auch geplanten „Politikwechsels“ der kommenden Bundesregierung in allen vielseitig beteiligten „Bürokratieetagen und – Köpfen oben und unten“ den „Denk- und Musterwechsel“, dass in unserem Gemeinwesen nicht immer mehr und detailliertere Vorschriften ein Gewinn sind, sondern eben weniger und damit mehr Freiheit in Eigengestaltung und –Verantwortung! Es braucht dazu die „MENTALE Transformation“ im Digitalen Zeitalter mit besonderem Blick auf die Standortqualität und die Bedarfe für und von Unternehmen und „Made in Germany“!
Zum anderen braucht es – wenn denn „one in, two out“ nicht auch zu einem weiteren „zahnlosen Programmsatz“ in Sachen Bürokratieabbau degenerieren soll – gesetz-geberische Verbindlichkeit für eine zentrierte strategische und operative Steuerung, die mit konsequenten Vorgaben, inhaltlich, verfahrensmäßig und zeitlich, Beweislasten umkehrt und Abbau wirklich auch belohnt – wertschätzend für alle Ideengeber und Betroffene! Ein Beispiel und einen Versuch dazu hat es im Landtag NRW in der Vergangenheit gegeben: Gesetzentwurf der FDP Landtagsfraktion NRW aus dem Jahre 2001 – Bürokratieabbaugesetz NRW, Steuerungsgesetz zum Bürokratieabbau und zur Standortinitiative NRW, LT.Drs. 13/887; hier als PDF abrufbar. Weitergehende Beispiele, Ideen und Impulse hat auch der Nationale Normenkontrollrat –NKR – vorbildlich geliefert; auch aus anderer und eigener Ideenschmiede in über 50 jähriger Abbauzeit von Bürokratie und Regelungsdichte gibt es Verwertbares: „Düsseldorfer Entfesselungsimpulse 2006: Wachstum freisetzen! Beschäftigung fördern! Neue Wege in die Köpfe! Vom Reden zum Handeln! Die Bürokratie dauerhaft beschneiden!“ Mit dem darin u.a. schon formulierten konkreten Merkposten: „Für eine neue Vorschrift zwei alte aufheben!“ Hier abrufbar und hier weitere Informationen dazu.
Mit „one in, two out” kann nach über 50 Jahren ein neues „Kapitel Bürokratieabbau“ aufgeschlagen werden, wenn das nicht gelingt, wäre dann irgendwann wohl eher die im Rheinland so benannte „heitere Resignation“ die Folge. (Wilfried Kruse)
Der Autor war Beigeordneter der Landeshauptstadt Düsseldorf und ist Mitinhaber des Instituts ivmhoch2.
Stadt gegen Land – Ost gegen West
Stadt und Land werden in vielen politischen Debatten als Gegensätze positioniert. Der fortschrittlichen und liberalen Stadtbevölkerung stehe die rückständige und illiberale Landbevölkerung gegenüber. Als Beleg werden unter anderem Wahlergebnisse der AfD genannt. Der Humangeograph Johann Braun hat in seinem Buch „Stadt von rechts“ belegt, wie einseitig eine solch vereinfachende Sicht der Dinge ist. Auch in den Städten gibt es genügend Anknüpfungspunkte für die neue Rechte. Der Vollständigkeit halber: auch auf dem Land gibt es viele Menschen, die alles andere sind als illiberal und rückständig. Dazu ein interessantes Interview mit ihm und Norbert Reichel aus dem Demokratischen Salon.
EU-Kommission vereinfacht Entwaldungsverordnung
Durch Vereinfachungen und eine Verringerung des Verwaltungsaufwands soll die Umsetzung der europäischen Entwaldungsverordnung für Unternehmen und Behörden erleichtert werden. Am 16. April 2025 legte die Europäische Kommission (KOM) dazu Leitlinien mit Erläuterungen zur Anwendung der Verordnung und einen Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Bürokratie vor.
Im Dickicht der Bürokratie: Warum Digitalisierung im Sozialrecht nur radikal wirken kann
Deutschland ist ein Sozialstaat. Im Jahr 2023 werden nach Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales rund 1.249 Milliarden Euro für Sozialleistungen ausgegeben. Dieses gewaltige Sozialbudget wird von Tausenden von Trägern verwaltet. Charakteristisch für Deutschland ist die Trägervielfalt: Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherungsträger und Wohlfahrtsverbände teilen sich die Verantwortung. Die Kommuen und freie Träger sind oftmals Landesbestimmungen ausgeliefert die verhindern, dass digital first umgesetzt werden kann. Die Rechtsprechung hat die Ansprüche auf Sozialleistungen weiter ausdifferenziert und damit die Komplexität massiv erhöht – mit der Folge eines immer höheren Verwaltungsaufwandes. Hinzu kommen immer detallierte Vorgaben der Politik, oftmals ohne den Vollzug in den Kommunen mit zu betrachten.
Vernetzung der Akteure? Fehlanzeige. Digitalisierung spielt bisher nur eine untergeordnete Rolle. Zwar gibt es zahlreiche und wirkungsvolle Fachverfahren und erste KI-gestützte Ansätze, etwa bei der Bearbeitung von Wohngeldverfahren. Die Beratung durch Chatbots steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. Plattformen wie kooperationsgebote-sozialrecht.de, sozialplattform.de oder Leistungslotse.de decken meist nur Teilbereiche des Sozialrechts ab. Selbst die Jobcenter arbeiten mit einer eigenen App der Bundesagentur für Arbeit.
Die Zahl der Einkommensbegriffe ist Legion. Bereits 2021 warnte der Normenkontrollrat in einem über 125 Seiten starken Bericht vor der ausufernden Komplexität. Trotz der Schaffung von Sozialgesetzbüchern bleibt das Sozialrecht eine Black Box, die ohne Expertenwissen kaum zu durchschauen ist. Bürgerinnen und Bürger sehen sich oft gezwungen, mit mehreren Behörden zu verhandeln, um ihre Ansprüche durchzusetzen – wenn sie diese überhaupt kennen. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung nehmen bei der Grundsicherung im Alter 60 Prozent und beim Bildungs- und Teilhabepaket 43 bis 85 Prozent der Anspruchsberechtigten ihre Leistungen nicht in Anspruch.
Die Bilanz der Digitalisierung ist ernüchternd: Sie hat es bisher nicht geschafft, Schneisen in den Bürokratiedschungel zu schlagen. Prozesse werden digitalisiert, ohne die Strukturen grundlegend in Frage zu stellen. Dabei wäre es entscheidend, Verwaltungsleistungen nicht isoliert zu digitalisieren, sondern im Zusammenhang zu denken: Welche Leistungen können gebündelt, welche Verfahren vereinfacht, welche Anträge überflüssig gemacht werden?
Dies scheitert jedoch an unterschiedlichen Zuständigkeiten, gegenläufigen Finanzströmen und geteilten Zuständigkeiten. So führen das Nebeneinander von Bürgergeld (Kommunen) und Wohngeld (Bund) sowie Vorrang- und Nachrangregelungen zu einem unüberschaubaren Geflecht von Ausschlüssen. Das Ergebnis ist eine organisierte Verantwortungslosigkeit, in der sich niemand mehr zuständig fühlt.
Die Digitalisierung muss daher mit einer tiefgreifenden Staatsmodernisierung verbunden werden. Es reicht nicht, digitale Oberflächen zu schaffen. Zuständigkeiten müssen neu geordnet, Einzelfallgerechtigkeit zugunsten praktikabler Pauschalierungen überwunden, Nachweispflichten radikal reduziert werden. Der Versuch, die vorhandene Komplexität zu digitalisieren, ist ein Irrweg. Ziel muss es sein, diese Komplexität zu reduzieren – drastisch und sichtbar.
Andere Länder zeigen, dass es auch anders geht: In Estland etwa ermöglicht eine einheitliche digitale Identität über eine zentrale Plattform den Zugang zu nahezu allen staatlichen Dienstleistungen. Auch Dänemark setzt auf eine konsequente Vereinfachung der Bürokratie vor der Digitalisierung. Deutschland hingegen versucht, überkommene Strukturen lediglich digital zu konservieren.
Prof. Dr. Constanze Janda, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, wies kürzlich beim NEGZ-Brown Bag-Meeting auf zentrale Hindernisse hin: Neben der Trägervielfalt sind dies vor allem Datenschutzbedenken und die Gefahr, vulnerable Gruppen wie ältere oder behinderte Menschen zu benachteiligen. Auch die Ziele des Koalitionsvertrages – „Prozesse digitalisieren“ und „Daten besser nutzen“ – greifen zu kurz, wenn nicht gleichzeitig die strukturelle Komplexität angegangen wird.
Hier gibt es ermutigende Ansätze: Beim Grundrentenzuschlag im Alter wird bereits auf Anträge verzichtet; Anspruch und Leistung werden durch einen automatisierten Datenaustausch zwischen Rentenversicherung und Finanzbehörden ermittelt.
Fazit: Die Digitalisierung im Sozialrecht kann nur gelingen, wenn sie Teil einer umfassenden politischen Reform wird. Es bedarf einer konzertierten Aktion: Bündelung von Leistungen, radikale Transparenz, drastische Vereinfachung der Verfahren u.a. durch Antragslosigkeit. Nicht die Optimierung einzelner Prozesse ist gefragt, sondern die strategische Neuausrichtung des gesamten Systems. Digitalisierung ist Politik. Und sie erfordert den Mut, Bürokratie zu reduzieren. (Franz-Reinhard Habbel)
Neues aus den Kommunalen Spitzenverbänden
DST: Straßenverkehrsrecht setzt Städten viel zu enge Grenzen
BayGT: KOMMUNALE 2025 –Jetzt für den DIGITAL-Award 2025 bewerben!
HSGB: Hessischer Tourismuspreis 2025 ausgeschrieben
StGTMV: Weitere Entlastung der Kommunen bei Wohnungsbaualtschulden
Kopf der Woche: Lisa Kulemann, Stabsstelle interkommunale Zusammenarbeit und verantwortlioch für das Digital-Loste Sachsen-Anhalt Projekt.
Buch der Woche: Gemeinsam durchs Feuer: Mein Leben bei der Freiwilligen Feuerwehr | Die Autobiografie einer Feuerwehrfrau von Marie Trappen
Wenn Marie Trappen zum Einsatz gerufen wird, lässt sie alles stehen und liegen und macht sich auf den Weg zur Wache. Von dort geht es raus ins Ungewisse. Mal hat jemand im Altersheim das Essen auf dem Herd vergessen. Mal läuft durch einen Wasserrohrbruch der Keller voll. Mal brennt es an drei Orten in der Stadt gleichzeitig. Und immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, bei denen es um Leben und Tod geht und die den Helfenden nie mehr aus dem Kopf gehen. In ihrer Autobiografie lässt uns Marie Trappen an ihren ersten Gehversuchen als Feuerwehrfrau teilhaben. Anschaulich erzählt sie von den zahlreichen Ausbildungen, die sie durchlaufen musste. Und sie nimmt uns mit zu ihren spektakulärsten Einsätzen aus vierzehn Jahren Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Geschichten in diesem Buch verdeutlichen, wie sehr der gesellschaftliche Zusammenhalt sogar auf dem Dorf vom Engagement Einzelner abhängt. Ein unterhaltsames und empowerndes Feuerwehr-Buch für die Fans von „Feuer & Flamme“ und alle, die sich von den Erfahungen starker Frauen inspirieren lassen möchten.
Zahl der Woche: 24 %der Deutschen überlegen seit Beginn der neuen Amtszeit von Donald Trump, mit ihrem E-Mail-Postfach oder Cloud-Speicher zu einem Nicht-US-Anbieter zu wechseln oder haben dies bereits getan, sagt eine YouGov-Umfrage für GMX und Web.de (Quelle Turi2)
Chatbot der Woche: Hallo! Ich bin der Chatbot der Landeshauptstadt Stuttgart
Tweet der Woche: Patrick Kunkel, Bürgermeister Eltville am Rhein
mit Markenzeichen – KI macht’s möglich! Bevor der Actionfiguren-Trend vorüberzieht, wollten wir euch die Eltville 1.0 Edition noch fix präsentieren. Wir bleiben am Ball & schauen, wo wir als Verwaltung KI gezielt für uns nutzen können. Seid gespannt, was noch kommt!
Zu guter Letzt: Der Akku war leer: Rentner strandet mit E-Bike auf der Autobahn
Fotos: Screenshot ZDF – Markus Lanz und Übertragung Beerdigung Papst Franziskus Petersdom
Ihnen wurde der Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie in abonnieren
++++
Der ZMI kann kostenlos hier abonniert werden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ihr Franz-Reinhard Habbel